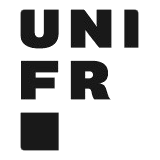In den letzten Jahren waren wir fast täglich mit Meldungen über gravierende Missbräuche bei der Fremdbetreuung von Kindern konfrontiert: Jenische Familien wurden auseinandergerissen, als «Verdingkinder» platzierte Kinder zur Schwerstarbeit gezwungen, unangepasste Jugendliche zur Disziplinierung zwangsweise in Heime und Anstalten eingesperrt, internationale Adoptionen missachteten rudimentärste Sorgfaltspflichten, katholische Priester vergingen sich en masse an den unter ihrer Obhut stehenden Kindern und Jugendlichen, ledige Mütter wurden gezwungen, ihre Neugeborenen zur Adoption freizugeben und oft einer Zwangssterilisation unterzogen. Wie die neue Forschung zeigt, waren diese Praktiken im 20. Jahrhundert gang und gäbe. Die Betroffenen wurden eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht. Sie hatten kaum Möglichkeiten, sich rechtlich gegen die «organisierte Willkür» der Behörden zur Wehr zu setzten. Wurden Missbräuche nicht systematisch vertuscht und verleugnet, so erregten sie lange kaum Anstoss in der Öffentlichkeit.
Diese Geschichte wiegt schwer und wirft viele Fragen auf. Wie und weshalb konnte es in der Schweiz als Rechtsstaat zu derartigen Missbräuchen kommen? Wer war davon betroffen und wer sind die Verantwortlichen? Wie stellen sich Staat und Politik zu diesen dunklen Kapiteln des schweizerischen Sozialstaats? Welche Lehren hat man daraus gezogen? Gibt es Bereiche im Sozialwesen, die auch heute noch besonders anfällig sind für Machtmissbrauch und Willkür? Wie kann man Betroffene besser schützen?
Dieser Kurs wird als partizipative Veranstaltung durchgeführt. Von den Teilnehmer:innen wird die aktive Teilnahme an den Kursdiskussionen sowie ein individueller Input (Referat) zu einem der Kursthemen erwartet. Als Leistungsnachweis gelten das Referat, die Beteiligung an der Diskussion und ein kurzer schriftlicher Essay basierend auf dem Referat.
- Enseignant·e: Regula Ludi