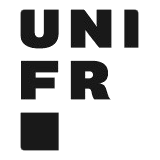Die Vorlesung bietet eine Einführung in den innovativen Ansatz der Literary Disability Studies anhand vergleichender Analysen literarischer Texte aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen. Ausgehend von grundlegenden theoretischen Konzepten der Disability Studies wird untersucht, wie Literatur körperliche und psychische Differenz verhandelt, welche ästhetischen Formen und narrativen Strategien dabei zum Einsatz kommen und wie sich literarische Darstellungen von Behinderung im historischen Verlauf wandeln. Der Schwerpunkt liegt auf der deutschsprachigen Literatur, die systematisch mit Texten aus anderen Literaturen (insbesondere der frankophonen, englischen und amerikanischen) in Beziehung gesetzt wird. Dabei werden auch Verbindungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten um Inklusion, Normalität und Differenz hergestellt.
- Enseignant·e: Johannes Görbert
Enseignement d’histoire littéraire ayant pour projet de lieu à la réalisation d’un projet commun (exposition virtuelle). Cet enseignement poursuit l’objectif d’esquisser une histoire comparée des littératures d’anticipation en Suisse. Pour ce faire, il s’agira d’articuler deux aspects du sujet :
- 1. histoire et théorie comparées des genres de l’imaginaire du point de vue du procédé de l’anticipation ;
- 2. analyse approfondie d’œuvres suisses emblématiques mettant en œuvre ce procédé.
- Enseignant·e: Romain Jacques Bionda
Ziel dieser auf zwei Semester angelegten und von verschiedenen DozentInnen der Philosophischen Fakultät gehaltenen Vorlesungen ist ein einführender, von der Antike bis zur Gegenwart reichender Überblick über die Literaturen Europas sowie Nord- und Südamerika. Ausgehend von einem spezifisch komparatistischen Blickwinkel vermittelt die Vorlesung einen Zugang zur altorientalischen, antiken, mittelalterlichen, spanischen, italienischen, englischen, amerikanischen, französischen, deutschen und slavischen Literatur.
Le cours, donné à tours de rôle par divers(e)s enseignant(e)s des Facultés des Lettres, présente, en survol, une introduction aux littératures occidentales depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. A partir d'un point de vue spécifiquement comparatiste, il offre un accès à la littérature orientale, antique, médiévale, espagnole, italienne, anglaise, américaine, française, allemande et slave.
- Enseignant·e: Sophie Jaussi