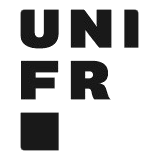Glossar
Caratteri speciali | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TUTTI
Pagina: 1 2 (Successivo)
TUTTI
G |
|---|
GenderDas Konzept Darüber hinaus wird das System der binären Kategorisierung selber unter die Lupe genommen. Tatsächlich ist die Zuordnung eines Menschen zu einer von zwei biologischen Geschlechterkategorien keineswegs immer eindeutig. Die Analyse der medizinischen Praxen rund um Intergeschlechtlichkeit zeigt vielmehr, dass auch das biologische Geschlecht als Gegenstand eines sozialen Konstruktionsprozesses zu verstehen ist. Schliesslich ist die binäre Geschlechterkategorisierung eng mit der Norm der Heterosexualität verbunden. Im Anschluss an die «Gay and Lesbian Studies» wird im Rahmen der «Queer-Theory» die Vielfalt von sexuellen Orientierungen und Geschlechterpositionen thematisiert, die das binäre System von Geschlecht in Frage stellen. Das angelsächsische Kürzel LGBTI verweist auf diese vielfältigen Positionen zu Geschlecht und Sexualität, die in westlichen Gesellschaften heute zur sozialen Realität gehören. Eine ausführliche Einführung in das Gender-Konzept findet sich bei Wetterer (2010) sowie bei Hark (2010). | |
Gender-KompetenzDie geschlechtergerechte Gestaltung der Hochschullehre erfordert von den Dozierenden, die eigene Gender-Kompetenz zu entwickeln. Hier eine Definition: «Gender-Kompetenz umfasst Wissen über Geschlechterverhältnisse und deren Ursachen sowie die Fähigkeit, dieses Wissen im alltäglichen Handeln anzuwenden und auf individueller Ebene zu reflektieren.» (Rosenkranz-Fallegger 2009:44) Rosenkranz-Fallegger (2009) unterscheidet folgende vier Dimensionen von Gender-Kompetenz:
2. Methodenkompetenz: Sie beinhaltet die Fähigkeit, Gender-Wissen in unterschiedliche Kontexte zu übersetzen. Für Sie als Lehrperson geht es um die Fähigkeit, Gender-Wissen in die Lehrinhalte Ihres Faches (vgl. Dimension «Fachinhalte») und in die methodische Gestaltung Ihrer Lehre (vgl. Dimension «Lehr-/Lernmethoden») zu übersetzen. Diese Umsetzung muss fach- und kontextspezifisch erfolgen. 3. Sozialkompetenz: Sie bezeichnet die Fähigkeit zur geschlechtersensiblen Gestaltung von beruflichen Beziehungen: die Fähigkeit, Diskriminierungen anzusprechen und zu transformieren, wie auch die Fähigkeit zum Umgang mit sozialen Rollen in Gruppen. Für Sie als Lehrperson ist damit die Kommunikation mit Ihren Studierenden angesprochen (vgl. Dimension «Kommunikation durch die Lehrperson») wie auch die Interaktionen unter Studierenden in Ihren Lehrveranstaltungen (vgl. Dimension «Interaktionen in der Lehre»). 4. Selbstkompetenz: Sie umfasst die Fähigkeit zur Selbstreflexion in Bezug auf die eigene Geschlechteridentität und auf eigene geschlechterbezogene Denk- und Handlungsmuster. Dies setzt eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema und eine gewisse Lernfähigkeit voraus. Damit ist Ihr Selbstverständnis als Dozentin oder Dozent angesprochen (vgl. Dimension «Selbstverständnis als Lehrperson»). » Literatur | |
Generisches MaskulinumDie Verwendung der männlichen grammatikalischen Form, um sich auf Personen sowohl männlichen wie auch weiblichen Geschlechts zu beziehen, wird als generisches Maskulinum bezeichnet. Hier einige Beispiele:
| |
Geschlechtergerechte LehreDer Begriff der «geschlechtergerechten Lehre» hat sich in den letzten Jahren im Zuge der Umsetzung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern in Institutionen des Bildungsbereiches durchgesetzt. Geschlechtergerechtigkeit in der Gestaltung der Lehre zielt darauf ab, allen Lernenden – unabhängig von ihrem Geschlecht – eine erfolgreiche Beteiligung am Lernprozess zu ermöglichen und gleiche Chancen im Erwerb von Bildungsqualifikationen zu gewährleisten. In Bezug auf die Studien- und Berufswahl (vgl. horizontale Segregation) wie auch in Bezug auf Karriere- und Aufstiegschancen (vgl. vertikale Segregation) bestehen im höheren Bildungsbereich nach wie vor Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. | |
Geschlechtergerechte Sprache – DefinitionGeschlechtergerechte Sprache ist eine Sprache, die Frauen und Männer gleichermassen sichtbar macht und gleichermassen anspricht. In jüngster Zeit wird damit auch die Vielfalt der Geschlechter jenseits der Binarität angesprochen (vgl. LGBTI - Queere Identitäten). Gebräuchlich sind zudem die Begriffe geschlechtersensible oder inklusive Sprache. Das generische Maskulinum erhebt den Anspruch, vom konkreten Geschlecht zu abstrahieren und beide Geschlechter zu repräsentieren. Verschiedene Studien konnten aber zeigen, dass das generische Maskulinum bei Probandinnen und Probanden tatsächlich weniger Vorstellungen von weiblichen Personen hervorruft als geschlechtergerechte Formen (Gygax et al. 2008, Heise 2000, Stahlberg & Sczesny 2001). Gygax et al. 2021 geben einen Überblick über die Forschungsergebnisse der letzten 30 Jahre zu diesem Thema. » Geschlechtergerechte Sprache – Regeln | |
Geschlechtergerechte Sprache – EinstiegTatsächlich hat sich gezeigt, dass der Gebrauch des generischen Maskulinums – trotz gegenteiliger Intention – nicht als neutral wahrgenommen wird, sondern bei den Beteiligten mehr Vorstellungen von männlichen Personen hervorruft (Gygax et al. 2008, Heise 2000, Stahlberg & Sczesny 2001). | |
Geschlechtergerechte Sprache – EnglischMöglicherweise halten Sie auch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache ab. Das Problem der Geschlechtergerechtigkeit von Sprache stellt sich im Englischen ebenfalls. Die Substantive kennen zwar kein grammatikalisches Geschlecht, doch mit dem nachfolgenden
Personalpronomen verweisen Sie ebenfalls auf das eine oder das andere Geschlecht. Dazu ein Beispiel: The director was invited to present the new project. She was accompanied by her assistant. Empfehlungen für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch im Englischen:
Auf der Seite des amerikanischen Verbandes «National Council of Teachers of English» finden Sie ein Positionspapier «Statement on Gender and Language», das besonderen Wert auf die Non-Binarität von Geschlecht legt: https://ncte.org/statement/genderfairuseoflang/ | |
Geschlechtergerechte Sprache – RegelnHier zum Einstieg die wichtigsten Regeln der geschlechtergerechten Sprache:
| |
Geschlechtergerechte Sprache – RessourcenEs gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Leitfäden zur geschlechtergerechten Sprache. Verschiedene Institutionen unterhalten auch Webpages zum Thema. Hier finden Sie einige weiterführende Angaben: Die Universität Freiburg empfiehlt die geschlechtersensible Sprache und bietet auf der Webseite der Dienststelle Gleichstellung, Diversität und Inklusion praktische Werkzeuge an: https://www.unifr.ch/uni/de/organisation/acad/gleichstellung-beforetransfert/geschlechtersensible-sprache.html Die Universität Bern bietet auf ihrer Webseite die Broschüre «Geschlechtergerechte Sprache» in einer ausführlichen sowie in einer Kurzversion an: https://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/chancengleichheit/themen/respektvolles_und_inklusives_studien__und_arbeitsumfeld/sprache/index_ger.html Die Fachhochschule Graubünden hat einen ansprechenden Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache publiziert: https://www.fhgr.ch/fileadmin/fhgr/diversity/Diversity-Gender_Sprachleitfaden.pdf Die Universität zu Köln hat einen umfassenden «Leitfaden für eine geschlechtersensible und inklusive Sprache» entwickelt, den Sie hier herunterladen können: https://gedim.uni-koeln.de/sites/genderqm/user_upload/Leitfaden_geschlechtersensible_Sprache_5.Auflage_2017.pdf | |
Geschlechterstereotype – Analyse der BildspracheDie Analyse der Bildsprache in der visuellen Kommunikation eignet sich besonders gut, um Ihre Studierenden für allfällige Geschlechterstereotype zu sensibilisieren. Dazu finden Sie hier einige Anregungen. Wählen Sie Bildmaterialien aus Ihrem Fachbereich, zum Beispiel die Website Ihres Fachbereichs, die Informationsbroschüre für künftige Studierende Ihres Studiengangs oder die Website eines für Ihr Lehrgebiet relevanten Unternehmens. Für die Analyse der Bildsprache der ausgewählten Materialien kann der folgende Fragenkatalog Ihren Studierenden als Instrument dienen:
| |
Pagina: 1 2 (Successivo)
TUTTI